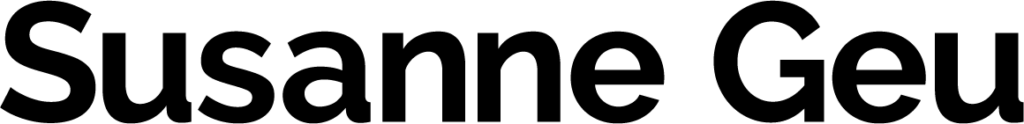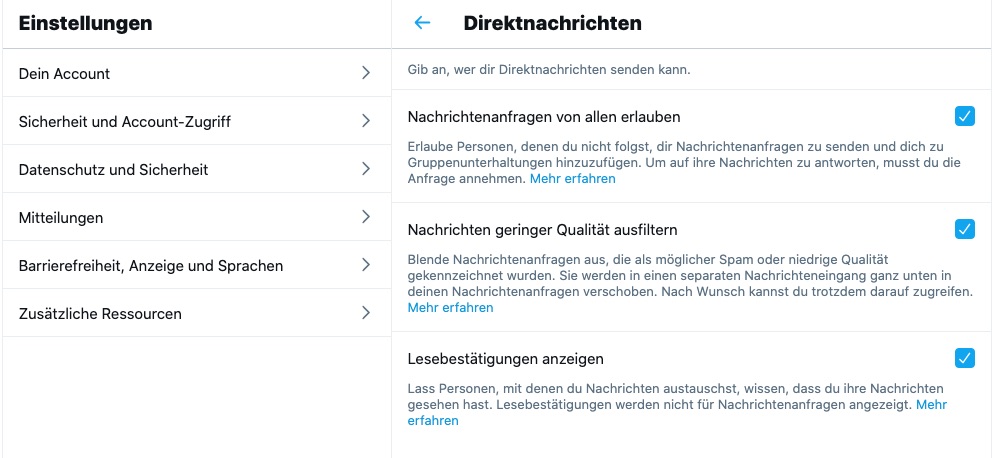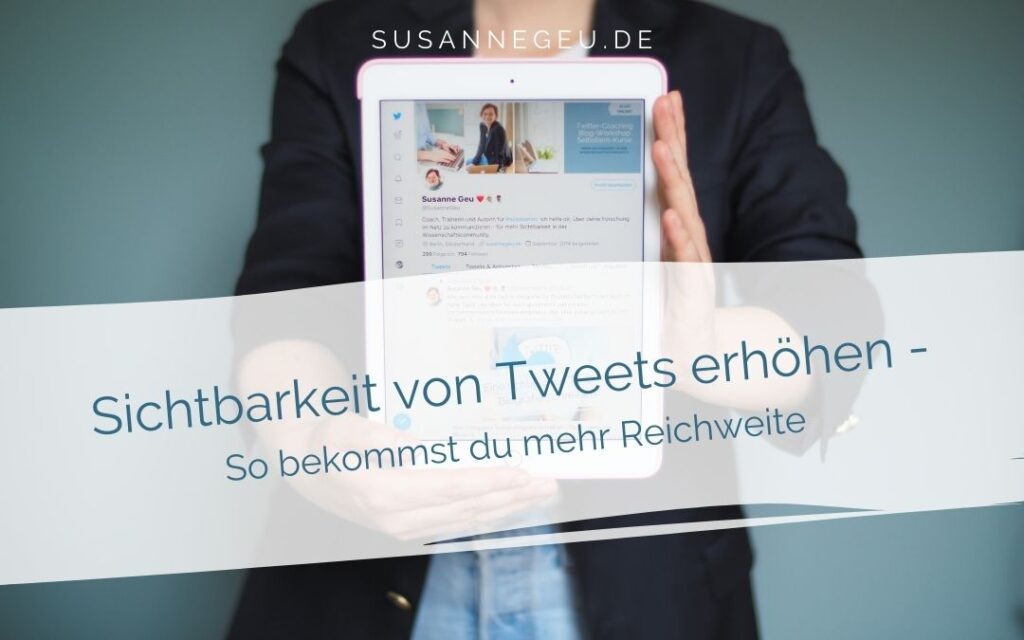Texte schreiben für Social Media – eine der größten Herausforderungen für Wissenschaftler*innen, wenn sie digital kommunizieren. Für dich auch?
Du hast bestimmt schon festgestellt, Texte in sozialen Netzwerken funktionieren anders als Blogartikel, Website-Texte oder wissenschaftliche Paper.
Aber wie gelingt es dir nun, über deine Forschung in Social Media so zu schreiben, dass du Interesse bei Kolleg*innen und Journalist*innen weckst?
Gleichgültig, wo du unterwegs bist – bei Twitter, Instagram oder LinkedIn – es geht darum, deine Community neugierig zu machen und zum Klicken, Teilen oder Kommentieren zu animieren.
In diesem Artikel verrate ich dir, worauf es beim Schreiben für Social Media ankommt. Und wie du mit deinen Texten größere Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken bekommst.
8 Tipps, die dir das Schreiben für Social Media leichter machen
1. Kenne dein Ziel und deine Zielgruppe
Am Anfang steht die Frage nach dem Ziel, das du mit deinem Beitrag erreichen möchtest.
- Willst du in erster Linie Aufmerksamkeit für einen neuen wissenschaftlichen Artikel bekommen?
- Soll der Beitrag deine Leser*innen dazu bringen, auf einen Link zu klicken, zum Beispiel zu einem Blogartikel, einem Anmeldeformular für eine Konferenz oder einer Videoaufzeichnung eines Vortrags?
- Willst du eine Diskussion anstoßen und hoffst auf möglichst viele Kommentare zu deiner Frage/deinem Statement?
“Stimme deinen Text auf dein Ziel und deine Zielgruppe ab.”
Je besser du weißt, welches Ziel du verfolgst, desto leichter kannst du deinen Text darauf abstimmen.
Mach dir gleichzeitig bewusst, für wen du schreibst. Welches Vorwissen kannst du bei deinen Leser*innen voraussetzen? Wie “ticken” sie? Welche Inhalte sind für sie besonders interessant?
Schreiben für Social Media heißt vor allem auch für eine bestimmte Zielgruppe schreiben.
2. Schreibe persönlich – egal ob als Individuum oder Institution
Mach dir bewusst, in welcher Rolle du deinen Text verfasst. Ich sehe nicht selten Personenaccounts (besonders bei Twitter), die schreiben als wären sie ihre eigene Pressestelle.
Das heißt, die Texte funktionieren nicht, weil sie nicht persönlich genug geschrieben sind. Sondern aus einer Distanz heraus, die in den sozialen Netzwerken nicht üblich ist.
Schreib am besten so, wie du sprichst. Und benutze das Wörtchen “ich”. Vielen Wissenschaftler*innen fällt gerade das sehr schwer, weil es in wissenschaftlichen Publikationen ein No-Go ist. Beim Schreiben für Social Media musst du daher umdenken.
Schreib persönlich – nicht wie deine eigene Pressestelle.”
Projektaccounts oder institutionelle Accounts können logischerweise nicht ganz so persönlich und individuell schreiben. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, die Distanz zum Publikum durch die Sprache zu verringern
Statt “ich” passt hier vielleicht ein “wir”. Leser*innen oder Follower*innen kann man immer mit “du/dich” oder “ihr/euch” einbeziehen. Unabhängig davon ob die Texte von einem Personenaccount oder einem Projektaccount stammen.
3. Formuliere kurz und prägnant
Komm gleich zu Anfang deines Textes auf den Punkt. Verzichte auf eine klassische Einleitung. In sozialen Netzwerken ist kein Platz für komplexe Formulierungen.
Außerdem haben deine Leser*innen keine Zeit. Sie entscheiden (und müssen das sogar angesichts der Flut an Informationen) in wenigen Sekunden über lesen oder nicht-lesen.
Durchsuche deinen Text nach unnötigen Füllwörtern (“übrigens”, “etwas”, “grundsätzlich”) und streiche sie. Verwende nicht zu viele Wörter in einem Satz. Am besten bleibst du unter 14 Wörtern.
Die Herausforderung dabei ist, sprachlich trotzdem abwechslungsreich zu schreiben. Also variiere die Satzlänge. Und nutze am besten aktive Sprache. Die klingt immer lebendiger als Passivkonstruktionen.
4. Baue deine Texte nach der ABI-Formel auf
Häufig sind erfolgreiche Texte in Social Media nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut. Sie folgen dem Dreischritt: Aufmerksamkeit schaffen – Botschaft rüberbringen – Interaktion anregen.
- Aufmerksamkeit: Das muss der erste Satz schaffen. Schildere ein Problem, eine Frage, eine Geschichte, wozu deine Zielgruppe eine Verbindung herstellen kann und die im besten Fall Emotionen weckt.
- Botschaft: Im nächsten Schritt kannst du dein Anliegen/dein Thema rüberbringen. Warum schreibst du diesen Post? Was ist der Anlass?
- Interaktion: Stell abschließend eine Frage an deine Community, bitte sie um ihre Meinung oder frage nach ihren Erfahrungen. Du kannst auch eine Aufforderung (Call to Action) formulieren, was deine Leser*innen als nächstes tun können (zum Beispiel Link anklicken für weitere Infos oder zum Download des Papers).
Hier mal ein Twitter-Beispiel von mir
Wie sieht eine gute Twitter-Biografie für Wissenschaftler*innen aus? Ich habe Tipps und Ideen für euch gesammelt und ein paar nachahmenswerte Beispiele eingebaut. Wer alles dabei ist, seht ihr im Thread.👇 #wisskomm #wissenschaftstwitter https://t.co/mU1sCCKpSu
— Susanne Geu ❤️👩🏼🔬👨🏽🔬 (@SusanneGeu) January 8, 2020
5. Hab einen Themen-Plan
Einfach so darauf los zu schreiben kann ziemlich schwierig sein. Besonders wenn du gar nicht weißt, worüber du jetzt schreiben könntest. Damit diese Situation so gar nicht eintritt, hilft es, einen Themenplan zu haben. Oder bestimmte Text-Kategorien, die dir immer neue Ideen liefern.
Das können zum Beispiel regelmäßige Formate sein wie:[
- Vorbereitung/Ergebnisse/Erkenntnisse aus der Lehre
- Literaturtipps
- Meilensteine der Promotion
- Einblicke in Forschungsprozess/Forschungsmethoden
- Blick hinter die akademischen Kulissen (z. B. auch mit Fotos)
- Empfehlung von Blogartikeln/redaktionellen Beiträgen
Oder Ideen, die eher zu bestimmten Terminen Sinn machen, wie:
- Berichte über Wissenschaftsevents und Konferenzen
- “Wissenschaftliche Feiertage” (11.02.: International Day of Women and Girls in Science, 14.03.: Pi Day)
- spontane Neuigkeiten: Förderzusagen, Jobzusagen etc.
6. Schreibe emotional
Schreiben für Social Media heißt auch emotional schreiben. Wobei emotional schreiben nicht automatisch bedeutet, Wissenschaft in rührselige Geschichten zu verpacken oder deinen Leser*innen die Tränen in die Augen zu treiben.
Es geht eher um den Ansatz, auch mal persönliche Stories und persönliche Ansichten zu teilen. Etwas, womit sich deine Follower*innen und Kontakte identifizieren können. Etwas, das sie direkt anspricht. Weil wir alle Menschen sind und vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
Welche alltäglichen Momente oder Probleme könntest du aufgreifen, die deine Leser*innen garantiert auch kennen? Den Antragswahnsinn für Fördermittel? Den Frust über Befristungen? Die Schreibblockade, wenn man als Wissenschaftler*in vor dem leeren Word-Dokument sitzt?
7. Schreibe deine Texte mit Mehrwert
Mehrwert klingt im ersten Moment vielleicht sperrig. Aber im Grunde ist es unter allen Tipps der wichtigste Punkt. Wenn du Texte für Social Media schreibst, sollte der Beitrag deine Leser*innen informieren oder unterhalten.
Versuche die Perspektive zu wechseln und frage dich, was deine Leser*innen für sich aus diesem Beitrag ziehen können. Stell genau das in den Vordergrund. Und formuliere den Mehrwert explizit, wenn es passt.
Zum Beispiel:
- “Ich möchte euch auf folgendes Event hinweisen…”
- “Diese Erfahrung habe ich im Seminar mit meinen Studierenden gemacht. Vielleicht ist sie auch für euch hilfreich…”
- “Bei der Literatursuche bin ich auf XY gestoßen. Diese Entdeckung gebe ich gerne weiter…”
8. Behalte deinen Kommunikationstil bei
Was du vielleicht nicht wusstest: Menschen lesen dich auch aufgrund dessen, WIE du schreibst. Ihnen gefallen nicht nur deine Themen, sondern ebenso die Wahl deiner Worte. Außerdem sind Menschen Gewohnheitstiere. Etabliere und pflege daher einen konsistenten Schreibstil.
Bonus-Tipp: Schreibe einfach
Die große Angst unter Wissenschaftler*innen ist oft, in Social Media nicht professionell genug zu klingen. Denn Social Media verlangt aufgrund der (oft) begrenzten Zeichenzahl und des aufmerksamkeitsheischenden Charakters, in einfachen Schlagworten zu texten.
“Einfach schreiben erfordert besonders viel Arbeit.”
Aber ganz ehrlich: Einfach und schlicht klingende Texte sind meistens die, in die besonders viel Arbeit geflossen ist. Sich hinter Phrasen, Schachtelsätzen und Fachbegriffen zu verstecken, kann “leichter” sein, als Dinge einfach auf den Punkt zu bringen.
Auch wenn einfach schreiben gar nicht so einfach ist. Es lohnt sich. Verständlich geschriebene Posts werden häufiger geteilt und gelikt.